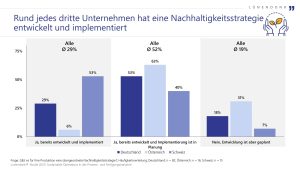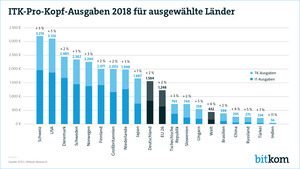Hilfsmittel für die Fertigung
Werkzeuge direkt drucken
In Köln entwickelt Ford neue Fahrzeugdesigns, die in Kleinauflage gefertigt werden, bevor sie in Serie gehen. Mittels 3D-Druck werden die notwendigen Montagevorrichtungen vor Ort entwickelt und hergestellt.

Verglichen mit den Kosten für herkömmlich hergestellte Tools spart Ford durch die 3D-gedruckten Vorrichtungen und Schablonen ca. 1.000 Euro pro Teil ein. (Bild: Ultimaker B.V.)
Die Automobilindustrie zählte zu den ersten Branchen, die die Vorteile des 3D-Drucks für sich entdeckt haben. Die additive Fertigung führte dazu, dass sich die Entwicklungs-, Design-, Beschaffungs-, und Fertigungsprozesse der Autobauer in den letzten zehn Jahren signifikant verändert haben. Die Folge sind ergonomische und leichte Teile, komplexes Design, niedrigere Kosten und verkürzte Lieferzeiten. Und dabei erschließt die Automobilbranche kontinuierlich neue Anwendungsfelder für die additive Fertigung. Wurde 3D-Druck bis vor einigen Jahren in erster Linie für visuelles Prototyping genutzt, findet heute die Entwicklung von kundenspezifischen Vorrichtungen, Werkzeugen, Schablonen und Muster zunehmend Verbreitung. In Zukunft kann das additive Fertigungsverfahren das Ersatzteilemanagement und die Herstellung von Teilen am Bestimmungsort revolutionieren.
Entwicklung bis zur Serienreife
Während viele Unternehmen erst beginnen, die Möglichkeiten der additiven Fertigung für sich zu entdecken, ist der Autobauer Ford schon einen Schritt weiter. Im Werk in Köln wird 3D-Druck eingesetzt, um den Workflow für die Herstellung von produktspezifischen Vorrichtungen, Werkzeuge und Schablonen bereits während des Designs zu optimieren. Die dortige Pilotanlage Pilot Plant verfügt über eine komplette Kleinserienfertigung, in der die Fahrzeugdesigns, häufig über einen Zeitraum von mehreren Jahren, bis zur Serienreife entwickelt werden. Die Ford-Ingenieure benötigen bereits während der Fahrzeugentwicklung eine Reihe verschiedener Montagewerkzeuge und -schablonen. Meist sind diese für einen bestimmten Zweck und ein spezielles Modell konzipiert. Die Beauftragung und die Beschaffung über externe Dienstleister ist nicht nur kosten- und zeitintensiv, sondern verlangsamt auch den Entwicklungsprozess. Um den Workflow zu optimieren, entschied sich das Additive Manufacturing-Team von Ford, Desktop-3D-Drucker des niederländischen Herstellers Ultimaker in den Arbeitsablauf zu integrieren und die Tools direkt vor Ort zu entwickeln und zu fertigen. “Ford hat sich für Ultimaker 3D-Drucker entschieden, weil die Qualität und Zuverlässigkeit der Druckergebnisse im optimalen Verhältnis zu den Kosten steht”, so Lars Bognar, Research Engineer Additive Manufacturing bei Ford.
Ergonomie der Tools verbessern
Ford verfolgte das Ziel, nicht nur die Entwicklungszeit neuer Fahrzeugmodelle zu verkürzen, sondern auch die Ergonomie der Tools zu verbessern. Mit einem eigenen 3D-Workshop kann Ford das Design der Montagehilfsmittel bereits exakt konstruieren, bevor ein neues Automodell in die Serienproduktion geht. Mittels Designiterationen und Feedbackrunden, werden die modellspezifischen Tools hinsichtlich Funktionalität, Ergonomie und Passgenauigkeit verbessert. Das offene Filamentsystem der Ultimaker 3D-Drucker ermöglicht mit einer Vielzahl von leichten PLA-Filamenten verschiedener Hersteller zu drucken und auch neue Materialien jederzeit zu ergänzen. “Dank der zahlreichen industrietauglichen Materialien am Markt ersetzen wir die bisherigen Fertigungshilfsmittel unserer Serienproduktion aus Metall durch ebenso robuste Tools, die bis zu 70 Prozent leichter sind”, erläutert Bognar.
Das könnte Sie auch interessieren

Vom 22. bis zum 26. April wird Hannover zum Schaufenster für die Industrie. Neben künstlicher Intelligenz sollen insbesondere Produkte und Services für eine nachhaltigere Industrie im Fokus stehen.‣ weiterlesen

Eine Umfrage von Hewlett Packard Enterprise (HPE) unter 400 Führungskräften in Industrie-Unternehmen in Deutschland zeigt, dass zwei Drittel der Befragten den Data Act als Chance wahrnehmen. Der Data Act stieß unter anderem bei Branchenverbänden auf Kritik.‣ weiterlesen

Carbon Management-Technologien stehen im Fokus, um CO2-Emissionen zu reduzieren und zu managen. Die Rolle des Maschinenbaus und mögliche Entwicklungspfade betrachtet eine neue Studie des VDMA Competence Center Future Business.‣ weiterlesen

Deutsche Unternehmen nehmen eine zunehmende Bedrohung durch Cyber-Angriffe wahr. Das zeigt eine aktuelle Umfrage vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag von 1&1 Versatel, an der mehr als 1.000 Unternehmensentscheider teilnahmen.‣ weiterlesen

Hohe Geschwindigkeit und hohe Erkennungsraten sind die Anforderungen an die Qualitätskontrolle in der Verpackungsbranche. Wie diese Anforderungen erreicht werden können, zeigt das Unternehmen Inndeo mit einem Automatisierungssystem auf Basis von industrieller Bildverarbeitung und Deep Learning.‣ weiterlesen
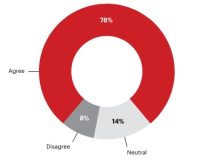
Laut einer Studie der Unternehmensberatung Bain & Company könnten Unternehmen ihre Produktivität durch digitale Tools, Industrie 4.0-Technologien und Nachhaltigkeitsmaßnahmen steigern. Deren Implementierung von folgt oft jedoch keiner konzertierten Strategie.‣ weiterlesen

Jeder zweite Betrieb investiert laut einer Betriebsräte-Befragung der IG Metall zu wenig am Standort. Demnach verfügen rund 48 Prozent der Unternehmen über eine Transformationsstrategie. Zudem sehen die Betriebsräte ein erhöhtes Risiko für Verlagerungen.‣ weiterlesen
Ziel des neuen VDMA-Forums Manufacturing-X ist es, der zunehmenden Bedeutung von Datenräumen als Basis für neue, digitale Geschäftsmodelle Rechnung zu tragen. Wie der Verband mitteilt, soll das Forum auf dem aufbauen, was in der letzten Dekade durch das VDMA-Forum Industrie 4.0 erarbeitet wurde. ‣ weiterlesen

Ob es sich lohnt, ältere Maschinen mit neuen Sensoren auszustatten, ist oft nicht klar. Im Projekt 'DiReProFit' wollen Forschende dieses Problem mit künstlicher Intelligenz zu lösen.‣ weiterlesen

Wie kann eine Maschine lernen, sich in unserer Lebenswelt visuell zu orientieren? Mit dieser Frage setzen sich die Wissenschaftler am Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz (DFKI) aktuell auseinander – und entwickeln Lösungen.‣ weiterlesen

Die seit 2020 geltende staatliche Forschungszulage etabliert sich im deutschen Maschinen- und Anlagenbau mehr und mehr als Instrument der Forschungsförderung. Ein wachsender Anteil der Unternehmen nutzt die Forschungszulage. Besonders geschätzt werden die verbesserten Finanzierungsmöglichkeiten sowie der erleichterte Zugang zur staatlichen Förderung von Forschung und Entwicklung (FuE).‣ weiterlesen