Kommentar von Nathan Howe, VP Emerging Technologies bei Zscaler
OT muss sich vom Netzwerkrauschen freimachen
Digitale Technologien werden zwar immer mehr zum Wettbewerbsfaktor, ihre Einführung braucht jedoch oft Zeit. Nathan Howe, Vice President Emerging Technologies beim Cloud-Spezialisten Zscaler, erklärt im folgenden Beitrag, warum Unternehmen um digitale Technologien nicht herum kommen und welche Aspekte es darüber hinaus zu beachten gilt.

(Bild: ©HERRNDORFF/stock.adobe.com)
Bis digitale Neuheiten in Produktionsstraßen zum Einsatz kommen, ist es oft ein steiniger Weg. Die Crux besteht darin, dass sich die Produktion keine Ausfallzeiten erlauben kann, um neue Technik nachzurüsten. Innovationszyklen in Produktionsumgebungen sind lang, weil kostspielig und sich die alten Maschinen erst noch amortisieren müssen. Allerdings kann ein allzu langes Abwarten nachteilig für den Geschäftsbetrieb sein. Denn für neue Geschäftsideen in Greenfield-Umgebungen kommen neue Technologien schneller zum Einsatz und treten an, um alteingesessene Produktionsmodelle zu übervorteilen. Zwar sind innovative Ansätze und Technologien vorhanden, aber deren Einsatz mit großen Umwälzungen einhergehen muss. Durch die Digitalisierung von OT im Zusammenspiel mit 5G kommt die nächste Innovationswelle unaufhaltsam ins Rollen. Doch bei deren Einführung ist mehr zu beachten als nur die Implementierung eines neuen technologischen Ansatzes. Es geht vielmehr um die Ablösung von Althergebrachtem und die Orchestrierung neuer Prozesse.
Fehler aus der Vergangenheit vermeiden
Zukünftig wird kaum ein Gerät oder eine Maschine um die vernetzte Welt herumkommen. Ohne IP-Adresse und damit Anbindung an die grenzenlose Konnektivität geht zukünftig in der Fertigung nichts mehr. Allerdings beginnt sich damit die Geschichte der IT für OT-Umgebungen zu wiederholen – leider nicht zu ihrem Vorteil. Das Internet begann als offene, freie Umgebung, in der jeder alles verbinden konnte. Erst als immer mehr Geräte angeschlossen und darauf aufbauend immer mehr Daten über das Internet transportiert werden mussten, begannen die Unternehmen den Zugang zu limitieren und den Informationsaustausch abzusichern.
Nachgelagert wurde mit Hilfe von Firewalls für die Einschränkungen der Sichtbarkeit und damit Erreichbarkeit von außen und somit wurde für mehr Sicherheit im Netzwerk gesorgt. Fehler, die mit der Anbindung der Unternehmens-IT an das Internet gemacht wurden, treten an sich in OT-Umgebungen zu wiederholen. Wenn nun einzelne Roboterarme oder ganze Geräteparks über das Internet angesteuert werden können und Sensoren millionenfach Daten über IoT-Geräte auslesen und über das Internet weiterleiten, und Drittparteien zu Fernwartungszwecken auf kritische Infrastrukturen zugreifen müssen, so muss auch hier bereits in der Planung das nötige Sicherheitsniveau berücksichtigt werden. Alles, was über eine IP-Adresse erreichbar ist, muss über Zugriffsbeschränkungen verfügen, sodass Daten und Geräte nur für autorisiertes Personal sichtbar sind. Allerdings sind Unternehmen für den Zugang zu ihren IoT- und OT-Geräten oft noch zu sehr im Netzwerk-zentrierten Ansatz verwurzelt.
IoT- und OT-Maschinen werden erst einmal ins Netzwerk eingebunden und dann mit Zugangshürden eingeschränkt. In der Folge kämpfen die Verantwortlichen für die Produktionsumgebungen mit den gleichen Herausforderungen wie die IT-Administratoren. Unternehmen tun also gut daran, sich vor der Digitalisierung Gedanken zu machen über die Folgen und Risiken der Interkonnektivität. Genauso wie die IT heute beginnt über Zero Trust neue Sicherheitskonzepte zu implementieren, die nicht mehr auf Netzwerk-Zugang beruhen, kann das Prinzip des ‘Least Privileged Access’ auch für OT-Umgebungen ins Auge gefasst werden.
Die Orchestrierung der Produktionsumgebungen
Der Versuch, Betriebstechnologie (OT) und mit dem Internet der Dinge (IoT) verbundene Geräte innerhalb einzelner ‘Walled Gardens’ zu verwalten und zu kontrollieren, übersieht etwa, dass langfristig eine Vielzahl miteinander verbundener Dienste verwaltet werden muss. Unternehmen, die sich zunehmend mehr Technologie für die Automatisierung von Geschäftsprozessen zu eigen machen, benötigen Weitblick. Es geht nicht mehr nur ausschließlich um die Orchestrierung von Technologie, sondern ebenso um die Orchestrierung von Geschäftsprozessen. Denn neue Technologie erfordert oft andere Verwaltungs- und Organisationsstrukturen. Der Weg führt weg von der Verkabelung von Maschinen zur Ansteuerung hin zur Software-Steuerung über das Internet bedingt ganz neue Verantwortlichkeiten. Die Überlegung, wer Zugriff zu einer Produktionsumgebung benötigt, rückt in den Fokus und damit einhergehend sind Regelungen zur Vergabe von Zugriffsrechten erforderlich, die Verwaltung von Passwörtern, und damit ganz neue Organisationsstrukturen.
Das könnte Sie auch interessieren

Vom 22. bis zum 26. April wird Hannover zum Schaufenster für die Industrie. Neben künstlicher Intelligenz sollen insbesondere Produkte und Services für eine nachhaltigere Industrie im Fokus stehen.‣ weiterlesen

Eine Umfrage von Hewlett Packard Enterprise (HPE) unter 400 Führungskräften in Industrie-Unternehmen in Deutschland zeigt, dass zwei Drittel der Befragten den Data Act als Chance wahrnehmen. Der Data Act stieß unter anderem bei Branchenverbänden auf Kritik.‣ weiterlesen

Deutsche Unternehmen nehmen eine zunehmende Bedrohung durch Cyber-Angriffe wahr. Das zeigt eine aktuelle Umfrage vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag von 1&1 Versatel, an der mehr als 1.000 Unternehmensentscheider teilnahmen.‣ weiterlesen

Carbon Management-Technologien stehen im Fokus, um CO2-Emissionen zu reduzieren und zu managen. Die Rolle des Maschinenbaus und mögliche Entwicklungspfade betrachtet eine neue Studie des VDMA Competence Center Future Business.‣ weiterlesen

Hohe Geschwindigkeit und hohe Erkennungsraten sind die Anforderungen an die Qualitätskontrolle in der Verpackungsbranche. Wie diese Anforderungen erreicht werden können, zeigt das Unternehmen Inndeo mit einem Automatisierungssystem auf Basis von industrieller Bildverarbeitung und Deep Learning.‣ weiterlesen
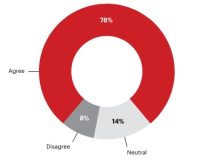
Laut einer Studie der Unternehmensberatung Bain & Company könnten Unternehmen ihre Produktivität durch digitale Tools, Industrie 4.0-Technologien und Nachhaltigkeitsmaßnahmen steigern. Deren Implementierung von folgt oft jedoch keiner konzertierten Strategie.‣ weiterlesen

Jeder zweite Betrieb investiert laut einer Betriebsräte-Befragung der IG Metall zu wenig am Standort. Demnach verfügen rund 48 Prozent der Unternehmen über eine Transformationsstrategie. Zudem sehen die Betriebsräte ein erhöhtes Risiko für Verlagerungen.‣ weiterlesen
Ziel des neuen VDMA-Forums Manufacturing-X ist es, der zunehmenden Bedeutung von Datenräumen als Basis für neue, digitale Geschäftsmodelle Rechnung zu tragen. Wie der Verband mitteilt, soll das Forum auf dem aufbauen, was in der letzten Dekade durch das VDMA-Forum Industrie 4.0 erarbeitet wurde. ‣ weiterlesen

Ob es sich lohnt, ältere Maschinen mit neuen Sensoren auszustatten, ist oft nicht klar. Im Projekt 'DiReProFit' wollen Forschende dieses Problem mit künstlicher Intelligenz zu lösen.‣ weiterlesen

Wie kann eine Maschine lernen, sich in unserer Lebenswelt visuell zu orientieren? Mit dieser Frage setzen sich die Wissenschaftler am Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz (DFKI) aktuell auseinander – und entwickeln Lösungen.‣ weiterlesen

Die seit 2020 geltende staatliche Forschungszulage etabliert sich im deutschen Maschinen- und Anlagenbau mehr und mehr als Instrument der Forschungsförderung. Ein wachsender Anteil der Unternehmen nutzt die Forschungszulage. Besonders geschätzt werden die verbesserten Finanzierungsmöglichkeiten sowie der erleichterte Zugang zur staatlichen Förderung von Forschung und Entwicklung (FuE).‣ weiterlesen


















