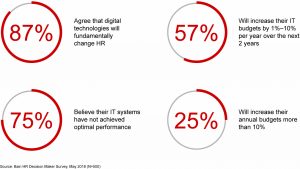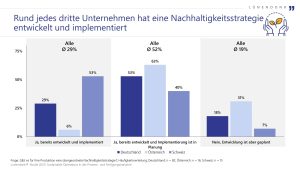Studie zur automobilen Kreislaufwirtschaft
Mit nachhaltigem Materialeinsatz zu geringeren CO2-Emissionen
Laut der Studie der Unternehmensberatung Bain & Company liegt der Anteil wiederaufbereiteter und -verwendeter Materialien bei europäischen Automobilherstellern in der Neuwagenfertigung bei 23 Prozent. Dieser Anteil könnte sich jedoch bis 2040 mehr als verdoppeln lassen.

Bild: ©安琦 王/stock.adobe.com
Mobilität ist derzeit die Ursache für rund 30 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen. Davon entfällt ein großer Teil auf den Straßenverkehr. Soll die Umweltbelastung über den Lebenszyklus eines Pkw hinweg minimiert werden, bedarf es nicht nur emissionsneutraler Antriebe, sondern auch neuer Ansätze entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das Spektrum reicht dabei vom nachhaltigen Design neuer Modelle über geschlossene Materialkreisläufe in der Produktion bis hin zu einer besseren Auslastung vorhandener Fahrzeuge. Europäische Autobauer sind laut einer Studie der Unternehmensberatung Bain & Company derzeit mit einer Quote von 40 Prozent weltweit führend in der Kreislaufwirtschaft. Dies sei vor allem auf strenge EU-Vorschriften zurückzuführen, so die Studienautoren. Untersucht wurden zentrale Stellhebel, mit deren Hilfe die automobile Kreislaufwirtschaft weltweit vorangetrieben werden kann. Aufgezeigt wird zudem, wie sich Autobauer und Zulieferer auf die neue Ära vorbereiten können.
Komplettes Pkw-Recycling möglich
Momentan entfallen weltweit rund 10 Prozent aller genutzten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe auf den Mobilitätssektor. Bei europäischen Automobilherstellern liegt der Anteil wiederaufbereiteter und -verwendeter Materialien in der Neuwagenfertigung bei 23 Prozent, könnte sich der Studie zufolge aber bis 2040 auf 59 Prozent mehr als verdoppeln lassen. Allein dies würde die mit dem Materialeinsatz verbundenen CO2- Emissionen um 60 Prozent reduzieren. Zugleich sei es möglich, so die Studienautoren, die Recyclingquote eines Pkw von heute knapp 80 Prozent auf 97 Prozent zu steigern – nahezu sämtliche Teile eines Fahrzeugs würden dann einer erneuten Verwendung zugeführt.
In der Bain-Studie werden auch nachgelagerte Wertschöpfungsstufen betrachtet. Danach ließe sich der Anteil gebrauchter Teile bei Reparaturen in Europa bis 2040 auf 12 Prozent steigern, im Jahr 2020 waren es gerade einmal 2 Prozent. Speziell bei Batterien werden Wiederaufbereitung und -verwendung künftig zum Standard werden, um die strengen regulatorischen Auflagen zu erfüllen. Dazu bedarf es aber eines professionellen Marketings. „Je intensiver sich die Autobauer dem Kreislaufgedanken verschreiben und je offensiver sie damit an die Öffentlichkeit gehen, desto leichter wird es den Servicebetrieben fallen, ihre Kundschaft von gebrauchten Ersatzteilen zu überzeugen“, stellt Dr. Klaus Stricker, Bain- Partner und Leiter der globalen Praxisgruppe Automotive und Mobilität, fest.
Nutzungsverhalten ändert sich
Auf dem Weg hin zur Klimaneutralität wird zudem ein verändertes Nutzungsverhalten eine wichtige Rolle spielen. Laut Studie wird sich voraussichtlich in den 2030er-Jahren der Einsatz von Robotaxis zunehmend rechnen. In der Folge wird der Anteil privater Fahrzeuge an den gefahrenen Kilometern weltweit von heute 67 Prozent auf dann rund 50 Prozent im Jahr 2030 sinken. 2050 sollen es sogar nur noch 40 Prozent sein. Die gesamthafte Auslastung aller Fahrzeuge würde damit deutlich steigen, der Bedarf an Neufahrzeugen zurückgehen. „Mobilität bleibt ein essenzieller Teil unseres Lebens“, sagt Noack. „Aber die Art, wie wir uns fortbewegen, wird sich grundlegend verändern“, sagt Björn Noack, Bain-Partner und Co-Autor der Studie.
Bei Vorreiterunternehmen stehen laut Studienergebnis drei Maßnahmen im Fokus. Zum einen überprüfen sie systematisch ihre gesamte Wertschöpfungskette, um die Chancen für geschlossene Kreisläufe nutzen zu können. Zum anderen geht es darum, Trends frühzeitig zu erkennen und auf Basis von Zukunftsszenarien schon heute die Weichen für die Märkte von morgen zu stellen. Und schließlich engagieren sie sich in Ökosystemen und beginnen gemeinsam mit Partnern mit dem Aufbau geschlossener Kreisläufe.
Das könnte Sie auch interessieren

Vom 22. bis zum 26. April wird Hannover zum Schaufenster für die Industrie. Neben künstlicher Intelligenz sollen insbesondere Produkte und Services für eine nachhaltigere Industrie im Fokus stehen.‣ weiterlesen

Eine Umfrage von Hewlett Packard Enterprise (HPE) unter 400 Führungskräften in Industrie-Unternehmen in Deutschland zeigt, dass zwei Drittel der Befragten den Data Act als Chance wahrnehmen. Der Data Act stieß unter anderem bei Branchenverbänden auf Kritik.‣ weiterlesen

Carbon Management-Technologien stehen im Fokus, um CO2-Emissionen zu reduzieren und zu managen. Die Rolle des Maschinenbaus und mögliche Entwicklungspfade betrachtet eine neue Studie des VDMA Competence Center Future Business.‣ weiterlesen

Deutsche Unternehmen nehmen eine zunehmende Bedrohung durch Cyber-Angriffe wahr. Das zeigt eine aktuelle Umfrage vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag von 1&1 Versatel, an der mehr als 1.000 Unternehmensentscheider teilnahmen.‣ weiterlesen

Hohe Geschwindigkeit und hohe Erkennungsraten sind die Anforderungen an die Qualitätskontrolle in der Verpackungsbranche. Wie diese Anforderungen erreicht werden können, zeigt das Unternehmen Inndeo mit einem Automatisierungssystem auf Basis von industrieller Bildverarbeitung und Deep Learning.‣ weiterlesen

Nach Bitkom-Berechnungen fehlen bis zum Jahr 2040 mehr als 660.000 IT-Fachkräfte. Welche Maßnahmen helfen könnten, diesem Trend entgegenzuwirken, hat der Verband beleuchtet. Potenziale liegen unter anderem darin, mehr Frauen für IT-Berufe zu begeistern oder den Quereinstieg zu erleichtern.‣ weiterlesen
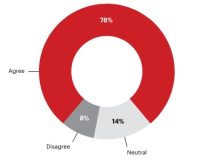
Laut einer Studie der Unternehmensberatung Bain & Company könnten Unternehmen ihre Produktivität durch digitale Tools, Industrie 4.0-Technologien und Nachhaltigkeitsmaßnahmen steigern. Deren Implementierung von folgt oft jedoch keiner konzertierten Strategie.‣ weiterlesen

Jeder zweite Betrieb investiert laut einer Betriebsräte-Befragung der IG Metall zu wenig am Standort. Demnach verfügen rund 48 Prozent der Unternehmen über eine Transformationsstrategie. Zudem sehen die Betriebsräte ein erhöhtes Risiko für Verlagerungen.‣ weiterlesen

Ob es sich lohnt, ältere Maschinen mit neuen Sensoren auszustatten, ist oft nicht klar. Im Projekt 'DiReProFit' wollen Forschende dieses Problem mit künstlicher Intelligenz zu lösen.‣ weiterlesen
Ziel des neuen VDMA-Forums Manufacturing-X ist es, der zunehmenden Bedeutung von Datenräumen als Basis für neue, digitale Geschäftsmodelle Rechnung zu tragen. Wie der Verband mitteilt, soll das Forum auf dem aufbauen, was in der letzten Dekade durch das VDMA-Forum Industrie 4.0 erarbeitet wurde. ‣ weiterlesen

Wie kann eine Maschine lernen, sich in unserer Lebenswelt visuell zu orientieren? Mit dieser Frage setzen sich die Wissenschaftler am Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz (DFKI) aktuell auseinander – und entwickeln Lösungen.‣ weiterlesen