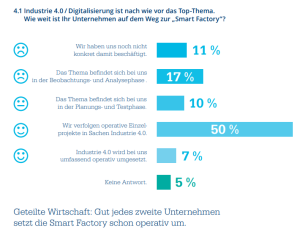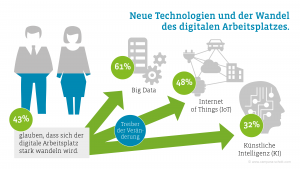Neue Realitäten in der Industrie
Augmented und Virtual Reality
transformieren die Produktionsumgebung
Lange führten Augmented und Virtual Reality (AR/VR) eher ein Nischendasein. Das ändert sich jedoch zunehmend aufgrund von stetigen Verbesserungen sowohl in Sachen Software als auch Hardware. Insbesondere in der Industrie gibt es spannende Ansätze und Anwendungsfälle für die Technologien – vom Einsatz beim Training über die Produktionsplanung und Qualitätskontrolle bis hin zum virtuellen Showroom. Aber wie gelingt die Umsetzung in der Praxis?

(Bild: Endava)
Die Idee, über eine Brille in andere Welten abzutauchen, ist nicht neu. Schon Mitte des letzten Jahrhunderts gab es Überlegungen und Geräte, die 3D-Erlebnisse boten. Der Spielkonsolenhersteller Nintendo brachte bereits 1995 mit dem Virtual Boy eine Art Vorgänger heutiger VR-Headsets auf den Markt – allerdings blieb der Erfolg aus. In den letzten Jahren hat VR jedoch einen Reifegrad entwickelt, der es erlaubt, in virtuelle immersive 3D-Welten einzutauchen, und dadurch eine praktische Nutzung in
vielerlei Bereichen ermöglicht. Ähnlich verhält es sich mit AR. Smartphones und ihre Verbreitung haben erheblich dazu beigetragen, dass die Technologie zugänglicher wurde und immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und noch schöpfen wir das volle Potenzial beider Technologien nicht aus. Dennoch gibt es bereits zahlreiche Use Cases, die konkrete Verbesserungen oder andere Vorteile bringen, auch und insbesondere in Industrie und Produktionsumgebungen.
AR und VR in der Anwendung
- Trainings und Schulungen: Ob es um die Einarbeitung neuer Mitarbeiter oder die Auffrischung der Kenntnisse erfahrener Mitarbeiter geht – Trainings sind gerade dann besonders wichtig, wenn es um die richtige Handhabung von Maschinen geht. Ist diese nicht gegeben, kann es im schlimmsten Fall zu Beschädigungen, Störungen des Betriebs oder sogar Verletzungen kommen. Um Teams vorzubereiten, können Unternehmen daher ganze Maschinen in einer VR-Anwendung abbilden oder auch mithilfe von AR Elemente direkt auf ein reales Objekt projizieren. In beiden Fällen lassen sich etwa bestimmte Handgriffe oder auch die Wartung üben, ohne den Geschäftsbetrieb zu unterbrechen oder unbeabsichtigt Störungen zu verursachen. Zudem hilft die Visualisierung von Prozessen dabei, sie zu verinnerlichen, zumal zusätzliche Informationen oder nächste Schritte eingeblendet werden können.
- Produktionsplanung: Maschinen müssen optimal geplant sein, um später so zu funktionieren wie angedacht. Das heißt, Mechanik, Elektronik und Software müssen perfekt ineinandergreifen. Erschwert wird dies jedoch dadurch, dass Maschinen immer komplexer werden. Daher kann es überaus hilfreich sein, sie zunächst als virtuelles Modell auf Basis von CAD-Daten zu bauen. Mit diesem kann man die Funktionsfähigkeit und Handhabung der Maschine ausführlich testen und so auch etwaige Abhängigkeiten von anderen Maschinen und Arbeitsprozessen sichtbar machen. Darüber hinaus kann auch der Produktionsprozess bis hin zu den Produktionslinien und dem Zusammenspiel mit den in der Produktion beteiligten Menschen simuliert werden.
- Prototyp- und Qualitätskontrolle: Am Anfang der Produktionskette können AR und VR auf ähnliche Weise zum Einsatz kommen, nämlich indem Unternehmen virtuelle Prototypen erstellen – entweder von neuen Produkten oder von neuen Komponenten bestehender Produkte. Dadurch lässt sich frühzeitig überprüfen, ob sie wie geplant funktionieren oder mit anderen Bestandteilen interagieren. Möglicherweise stellt sich bei dieser 3D-Simulation heraus, dass die Maße noch nicht ganz passen, ein wichtiger Aspekt nicht berücksichtigt wurde oder die Montage zu aufwendig ist. So können Kosten für physische Prototypen eingespart werden. Für komplexe Sensor-Arrays in Verbindung mit Maschine Learning kann auch synthetisches 3D-Trainingsmaterial erstellt werden, um die Sensorinputs zu simulieren. Am Ende der Produktionskette lässt sich wiederum kontrollieren, ob gefertigte Produkte den Vorgaben entsprechen. Hierfür bieten sich vor allem AR-Anwendungen an, um ein idealtypisches 3DModell über das fertige Produkt zu projizieren. Eventuelle Unterschiede sollten dadurch sichtbar werden.
- Virtuelle Showrooms: Um Kunden Produkte zu präsentieren, sind Messen weiterhin unabdinglich. Doch virtuelle Ausstellungsräume bieten ganz eigene Vorteile, etwa ein hohes Maß an Flexibilität. So können innerhalb von Sekunden Veränderungen vorgenommen werden, um Produkte an die Wünsche (potenzieller) Kunden anzupassen. Sie können diese auch selbst ausprobieren oder bei Demonstrationen zuschauen. Und natürlich entfällt die Notwendigkeit, durch die Welt zu reisen.
Gute Vorbereitung ebnet den Weg
Bei der Einführung neuer Methoden sollte der potenzielle Nutzen im Vordergrund stehen und nicht die Technologie an sich. Doch wie sollten Industrieunternehmen vorgehen, wenn sie ein solches Projekt umsetzen wollen? Klein anfangen und eine klare Strategie entwickeln, sollte die Devise sein, gerade wenn bisher wenig Erfahrung und Expertise mit AR und VR vorhanden sind. Es empfiehlt sich darüber hinaus auch, Projekte zu wählen, bei denen nur wenige Abhängigkeiten zu anderen Prozessen und Systemen berücksichtigt werden müssen. Unabhängig vom gewählten Anwendungsfall sollten am Anfang die Bedürfnisse und Anforderungen der späteren Nutzer definiert werden.
Dabei geht es um unterschiedliche Fragen: Welcher Teil eines Prozesses sollte virtuell abgebildet werden? Wie wird sichergestellt, dass die Anwendung zugänglich und nutzerfreundlich in den gesamten Prozess eingegliedert ist? Ist eine AR- oder VR-Anwendung sinnvoller und welches Endgerät kann dafür verwendet werden? Für beide Technologien gibt es leistungsstarke Headsets, Brillen und Head-Mounted-Displays. Die Wahl des passenden Geräts sollte dabei, neben der vorgesehenen Aufgabe, von verschiedenen Faktoren abhängen.
Dazu zählen der Preis und ergonomische Überlegungen, einschließlich des Gewichts, vor allem aber die Leistung: Wie hoch ist die Auflösung, wie groß das Sichtfeld, wie erfolgt das Tracking, wie lässt sich das Gerät steuern, lässt sich über das Gerät mit anderen kommunizieren und wie lange reicht der Akku? Welches Endgerät das beste ist, lässt sich daher nicht pauschal sagen, und die Weiterentwicklung in dieser Gerätekategorie ist rasant. Die Skalierung des Einsatzes sollte wohl überlegt und richtig dimensioniert sein.
Fehler gehören dazu
Darüber hinaus müssen sich alle Beteiligten bewusst sein, dass es Zeit brauchen wird, bis ein AR- oder VR-Projekt funktioniert. Fehler und Rückschläge gehören dazu und tragen zur stetigen Verbesserung bei. Unternehmen sollten sich dabei ein Beispiel an ihrem Vorgehen während der Covid-19-Pandemie nehmen: Aufgrund der Dringlichkeit, beispielsweise durch den Wechsel der Mitarbeiter ins Homeoffice, wurden neue Lösungen oft einfach implementiert und anschließend kontinuierlich verbessert und an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst.
Dieser agile, iterative Ansatz empfiehlt sich auch bei AR und VR, denn er trägt erheblich dazu bei, ein Produkt zu entwickeln, dass genau seinen Zweck erfüllt. Und davon profitieren die Nutzer und damit im Endeffekt das Unternehmen selbst. Wichtig ist dabei, eine Strategie zu etablieren, über das initiale Projekt hinaus zu planen und nicht alles auf eine Karte zu setzen. Durch den passenden und verhältnismäßigen Einsatz lassen sich schnell Erfolge erzielen und dann schrittweise greifbare Verbesserungen und essenzielle Einsparungen realisieren.
Das könnte Sie auch interessieren

Werkzeugbahnen für Zerspanprozesse in CAM-Systemen zu planen erfordert Expertenwissen. Viele Parameter müssen bestimmt und geprüft werden, um die Bahnplanung Schritt für Schritt zu optimieren. Im Projekt CAMStylus arbeiten die Beteiligten daran, diese Aufgabe zu vereinfachen - per KI-gestützter Virtual-Reality-Umgebung.‣ weiterlesen

In einer Studie von Techconsult in Zusammenarbeit mit Grandcentrix wurden 200 Unternehmen ab 250 Beschäftigten aller Branchen zum Thema ESG in ihren Unternehmen befragt. Die Studie hebt die zentrale Rolle der jüngsten CSR-Direktive der EU bei der Förderung von Transparenz und Nachhaltigkeit in Unternehmen hervor. Dabei beleuchtet sie die Fortschritte und Herausforderungen bei der Umsetzung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) im Zusammenhang mit der Nutzung von IoT-Technologien.‣ weiterlesen

AappliedAI hat vier KI Use Cases identifiziert, die es dem produzierenden Gewerbe ermöglichen, ihre Effizienz und Produktivität zu steigern. Mit der Anwendung bewährter Technologien können sich die Investitionen bereits nach einem Jahr amortisieren.‣ weiterlesen

Hinter jedem erfolgreichen Start-up steht eine gute Idee. Bei RockFarm sind es gleich mehrere: Das Berliner Unternehmen baut nachhaltige Natursteinmauern aus CO2 bindendem Lavagestein. Oder besser gesagt, es lässt sie bauen - von einem Yaskawa-Cobot HC10DTP.‣ weiterlesen

Mit über 2,2Mio.t verarbeitetem Schrott pro Jahr ist die Swiss Steel Group einer der größten Recyclingbetriebe Europas. Für seinen 'Green Steel', also Stahl aus recyceltem Material, arbeitet das Unternehmen an einem digitalen Zwilling des ankommenden Schrotts.‣ weiterlesen

Laut einer aktuellen Studie von Hitachi Vantara betrachten fast alle der dafür befragten Unternehmen GenAI als eine der Top-5-Prioritäten. Aber nur 44 Prozent haben umfassende Governance-Richtlinien eingeführt.‣ weiterlesen
61 Prozent der Unternehmen in Deutschland wollen laut einer Bitkom-Befragung per Cloud interne Prozesse digitalisieren, vor einem Jahr waren es nur 45 Prozent. Mittelfristig wollen die Unternehmen mehr als 50 Prozent ihrer Anwendungen in die Cloud verlagern.‣ weiterlesen

Mit generativer KI erlebt 'Right Brain AI', also eine KI, die kreative Fähigkeiten der rechten menschlichen Gehirnhälfte nachahmt, derzeit einen rasanten Aufstieg. Dieser öffnet aber auch die Tür für einen breiteren Einsatz von eher analytischer 'Left Brain AI'. Das zeigt eine aktuelle Studie von Pegasystems.‣ weiterlesen
Um klima- und ressourcengerechtes Bauen voranzubringen, arbeiten Forschende der Bergischen Universität Wuppertal in ihrem Projekt TimberConnect an der Optimierung von digitalen Prozessen entlang der Lieferkette von Holzbauteilen. Ihr Ziel ist unter anderem, digitale Produktpässe zu erzeugen.‣ weiterlesen

Rund zwei Drittel der Erwerbstätigen in Deutschland verwenden ChatGPT und Co. zumindest testweise, 37 Prozent arbeiten regelmäßig mit KI-Anwendungen. Doch auch Cyberkriminelle machen sich vermehrt die Stärken künstlicher Intelligenz zunutze - mit weitreichenden Folgen.‣ weiterlesen

Erstmals seit der Energiekrise verzeichnet der Energieeffizienz-Index der deutschen Industrie mit allen drei Teilindizes (die Bedeutung, Produktivität und Investitionen betreffend) einen leichten Rückgang. Mögliche Gründe erkennt EEP-Institutsleiter Professor Alexander Sauer in der Unsicherheit und der drohenden Rezession, der dadurch getriebenen Prioritätenverschiebung und der Reduktion von Produktionskapazität.‣ weiterlesen