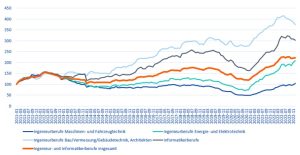Projekt IUNO Insec abgeschlossen
Digitale Köder
für Cyberkriminelle
Laut IT-Verband Bitkom haben Cyberkriminelle 2020 bei deutschen Unternehmen Verluste in Höhe von 223Mrd.€ verursacht. Das ist mehr als doppelt so viel wie zwei Jahre zuvor. Viele Großunternehmen haben ihre Sicherheitsvorkehrungen seitdem verstärkt. Aber die IT-Systeme von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sind immer noch in besonderem Maße durch Cyberattacken gefährdet.
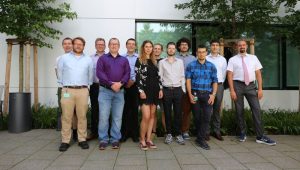
(Bild: Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit AISEC)
Die Digitalisierung sowie fehlende finanzielle Ressourcen und fehlendes fachliches Knowhow machen die Unternehmen oft zu einem einfachen Ziel für Angreifer. Um KMU dabei zu helfen, sich gegen Cyberangriffe zu schützen, haben Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft im vom Bundesministerium für Bildung und Foschung (BMBF) geförderten Projekt ‘IUNO InSec’ (Nationales Referenzprojekt zur IT-Sicherheit in Industrie 4.0) Lösungen entwickelt. Dazu gehören:
- • Einfach anzuwendende Werkzeuge zur Bedrohungsmodellierung und zur automatisierten Anomalie-Erkennung.
- • Lösungen für mehr Sicherheit bei der Nutzung von Industrial-Clouds.
- • Der sichere Fernzugriff auf Maschinen, u.a. für eine sichere Fernwartung.
- • Ein kontrollierbares, vertrauenswürdiges Nutzungsmanagement in verteilten digitalen Wertschöpfungsnetzen.
Cyberattacken und digitale Fallen
Der Forschungsbereich Intelligente Netze des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Kaiserslautern leitete im Projekt als Konsortialpartner die Entwicklung eines Ansatzes, der Angreifer in die Falle locken soll und deren Spuren zurückverfolgen kann. Dabei kommen Cyber Deception-Methoden zum Einsatz. Diese Technologie richtet sich gegen Angriffe auf die Vertraulichkeit, Integrität oder Verfügbarkeit kritischer Informationen in Unternehmen durch sogenannte Insider Threats und gegen die fortgeschrittene andauernde Bedrohung der lokalen IT-Infrastruktur vor Spionage und Sabotage (Advanced Persistant Threats).
Die Attacken werden oft erst spät, manchmal auch erst einige Monate, nachdem sie das Netzwerk infiziert haben, entdeckt. Doch sie lassen sich durch eine auf Täuschung (engl. Deception) basierende Anomalie-Erkennung frühzeitig aufspüren. DFKI-Projektleiter Daniel Reti erklärt die Methodik: “Sucht ein Angreifer im Netzwerk nach verwundbaren Servern, wird ihm eine erfundene Log-in-Seite durch den vorgeschalteten Deception Proxy präsentiert. Sobald der Angreifer mit einem solchen Köder interagiert, macht er sich erkenntlich.” Die Implementierung mittels Proxy soll es KMU einfach machen, die Deception-basierende Verteidigung anzuwenden, da die Täuschungselemente – sogenannte Honeytokens – nicht auf den Produktivsystemen abgelegt werden müssen, sondern in den Netzverkehr eingeschleust werden können.
Ein Werkzeugkasten für KMU
Mit den gesamten Werkzeugen aus dem Projekt können KMU ihr eigenes Sicherheitsniveau bestimmen, Zielgrößen für den gewünschten Schutz festsetzen und Maßnahmen zum Erreichen dieser Zielgrößen umsetzen. Die Unternehmen haben so die Möglichkeit, den eigenen Stand der IT-Sicherheit kontinuierlich zu evaluieren und frühzeitig anzupassen, etwa wenn neue Gefahren bzw. neue Anforderungen der Gesetzgebung oder der Kunden es erfordern. Der Werkzeugkasten umfasst:
Testbed zur Evaluation von IIoT-Security (Leitung: Fraunhofer AISEC): Das Testbed erlaubt eine dynamische Konfiguration von industriellen Netzwerkkomponenten, die auch Dritte nutzen können. Es kann verwendet werden, um das Verhalten der Produktionsumgebung mit und ohne Sicherheitslösungen im Angriffsfall zu simulieren. Für das Testbed wird nur ein Webserver benötigt, was seinen Einsatz in KMU vereinfacht. Die Bibliothek der unterstützten IIoT-Komponenten ist vorkonfiguriert und dynamisch durch Drag&Drop nutzbar. Auch eine Konfiguration eigener Geräte durch den Endanwender ist möglich.
Datenbasierte Anomalie-Erkennung (Leitung: Fraunhofer AISEC): Mit der Methodik lassen sich Abweichungen in verschiedenen Daten-Szenarien aufdecken, z.B. in Bilddateien, Netzwerkdatenströmen und Finanzdaten. Unerwünschte Zustände, die z.B. durch einen IT-Angriff auf Produktionskomponenten verursacht wurden, können frühzeitig erkannt und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Die Methode ist besonders für den Einsatz in heterogenen Produktionslandschaften geeignet und kann ohne Vorwissen über mögliche Anomalien eingerichtet und ausgeführt werden.
Kontinuierliche Bedrohungsmodellierung (Leitung: Fraunhofer SIT): Bedrohungs- und Risikomodellierungen sind dokumentenlastig und komplex. Eine browsergestützte grafische Benutzeroberfläche vereinfacht es, Architekturmodelle als Basis einer Bedrohungsmodellierung zu erstellen. Mithilfe einer Modellierungssprache und einem grafischen Werkzeug zur Erstellung von Bedrohungsmustern lassen sich bereits existierende Architekturmodelle einfach und nutzungsfreundlich kontinuierlich analysieren.
BAScloud (Leitung: accessec): Die BAScloud (BAS: Building Automation System) bildet Daten der lokalen Infrastruktur in einem digitalen Zwilling in der Cloud ab. Dies erfolgt durch digitale Erfassung, Normierung, Speicherung und Bereitstellung von Messdaten. Auch Sollwerte können sicher in die Infrastruktur zurückgesendet werden. Sie verfügt über eine Schnittstelle (API), um relevante Daten für Drittsysteme und -services verfügbar zu machen. Ein Rollen- und Rechte-System erlaubt ein feingliedriges Berechtigungsmanagement. Das technische Netzwerk ist vom Internet getrennt und bleibt so vor möglichen Cyberangriffen geschützt. Die BAScloud steht als Software-as-a-Service (SaaS) zur Verfügung.
Sicherer Fernzugriff auf Assets und Maschinen im Unternehmensnetzwerk (Leitung: axxessio): Die Lösung ist speziell für den Einsatz von sicheren Fernwartungsdienstleistungen konzipiert. Durch die Kombination von VPN- und SDN-Technologien werden sichere Verbindungen von außerhalb zu einem bestimmten Endpunkt innerhalb des Unternehmensnetzwerks hergestellt. Die Verwaltung der notwendigen Kontrollen läuft automatisiert ab. Für eine benutzerfreundliche Prozessgestaltung erfolgt die Planung und Durchführung der Fernwartungseinsätze über eine Cloud-Plattform mit verschlüsselter und authentifizierter Verbindung. Die eingesetzten Technologien sind Open Source verfügbar. Damit sind sie unabhängig von Drittanbietern und werden kontinuierlich von der Community weiterentwickelt.
Attributbasiertes Nutzungsmanagement (Leitung: TU Darmstadt): Digitale Wertschöpfungsnetze sind durch die dynamische Anzahl unterschiedlichster Teilnehmender geprägt. Das attributbasierte Nutzungsmanagement ermöglicht es, feingranulare Nutzungsregeln aufzustellen, während auf Basis der SDN-Technologie die Nutzung bzw. Kommunikation überwacht und gesteuert werden kann. Die dynamische, flexible und differenzierte Autorisierung und die Nutzungskontrolle erhöhen die Vertraulichkeit und Integrität der digitalen Kommunikation. Der Betrieb ist auf gängiger Hardware möglich, nur SDN-Switches sind zusätzlich erforderlich.
Simulationsbasierte Nutzungskontrolle (Leitung: TU Darmstadt): Um die attributbasierte Nutzungskontrolle optimal einzusetzen, werden genaue Kenntnisse über das zu überwachende System benötigt. Auf Grundlage von Verhaltenssimulationen, die der Produktentwicklung entstammen, kann ein digitaler Zwilling diese Informationen bereitstellen. Der Vergleich von simulierten Systemzuständen des digitalen Zwillings und zulässigen Systemzuständen dient insbesondere zur Verfeinerung der Nutzungskontrolle. Der Betrieb des Simulationsmodells ist auf gängiger Hardware möglich.
Das könnte Sie auch interessieren

Werkzeugbahnen für Zerspanprozesse in CAM-Systemen zu planen erfordert Expertenwissen. Viele Parameter müssen bestimmt und geprüft werden, um die Bahnplanung Schritt für Schritt zu optimieren. Im Projekt CAMStylus arbeiten die Beteiligten daran, diese Aufgabe zu vereinfachen - per KI-gestützter Virtual-Reality-Umgebung.‣ weiterlesen

AappliedAI hat vier KI Use Cases identifiziert, die es dem produzierenden Gewerbe ermöglichen, ihre Effizienz und Produktivität zu steigern. Mit der Anwendung bewährter Technologien können sich die Investitionen bereits nach einem Jahr amortisieren.‣ weiterlesen

Hinter jedem erfolgreichen Start-up steht eine gute Idee. Bei RockFarm sind es gleich mehrere: Das Berliner Unternehmen baut nachhaltige Natursteinmauern aus CO2 bindendem Lavagestein. Oder besser gesagt, es lässt sie bauen - von einem Yaskawa-Cobot HC10DTP.‣ weiterlesen

In einer Studie von Techconsult in Zusammenarbeit mit Grandcentrix wurden 200 Unternehmen ab 250 Beschäftigten aller Branchen zum Thema ESG in ihren Unternehmen befragt. Die Studie hebt die zentrale Rolle der jüngsten CSR-Direktive der EU bei der Förderung von Transparenz und Nachhaltigkeit in Unternehmen hervor. Dabei beleuchtet sie die Fortschritte und Herausforderungen bei der Umsetzung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) im Zusammenhang mit der Nutzung von IoT-Technologien.‣ weiterlesen

Mit über 2,2Mio.t verarbeitetem Schrott pro Jahr ist die Swiss Steel Group einer der größten Recyclingbetriebe Europas. Für seinen 'Green Steel', also Stahl aus recyceltem Material, arbeitet das Unternehmen an einem digitalen Zwilling des ankommenden Schrotts.‣ weiterlesen

Laut einer aktuellen Studie von Hitachi Vantara betrachten fast alle der dafür befragten Unternehmen GenAI als eine der Top-5-Prioritäten. Aber nur 44 Prozent haben umfassende Governance-Richtlinien eingeführt.‣ weiterlesen
61 Prozent der Unternehmen in Deutschland wollen laut einer Bitkom-Befragung per Cloud interne Prozesse digitalisieren, vor einem Jahr waren es nur 45 Prozent. Mittelfristig wollen die Unternehmen mehr als 50 Prozent ihrer Anwendungen in die Cloud verlagern.‣ weiterlesen

Mit generativer KI erlebt 'Right Brain AI', also eine KI, die kreative Fähigkeiten der rechten menschlichen Gehirnhälfte nachahmt, derzeit einen rasanten Aufstieg. Dieser öffnet aber auch die Tür für einen breiteren Einsatz von eher analytischer 'Left Brain AI'. Das zeigt eine aktuelle Studie von Pegasystems.‣ weiterlesen
Um klima- und ressourcengerechtes Bauen voranzubringen, arbeiten Forschende der Bergischen Universität Wuppertal in ihrem Projekt TimberConnect an der Optimierung von digitalen Prozessen entlang der Lieferkette von Holzbauteilen. Ihr Ziel ist unter anderem, digitale Produktpässe zu erzeugen.‣ weiterlesen

Rund zwei Drittel der Erwerbstätigen in Deutschland verwenden ChatGPT und Co. zumindest testweise, 37 Prozent arbeiten regelmäßig mit KI-Anwendungen. Doch auch Cyberkriminelle machen sich vermehrt die Stärken künstlicher Intelligenz zunutze - mit weitreichenden Folgen.‣ weiterlesen

Erstmals seit der Energiekrise verzeichnet der Energieeffizienz-Index der deutschen Industrie mit allen drei Teilindizes (die Bedeutung, Produktivität und Investitionen betreffend) einen leichten Rückgang. Mögliche Gründe erkennt EEP-Institutsleiter Professor Alexander Sauer in der Unsicherheit und der drohenden Rezession, der dadurch getriebenen Prioritätenverschiebung und der Reduktion von Produktionskapazität.‣ weiterlesen