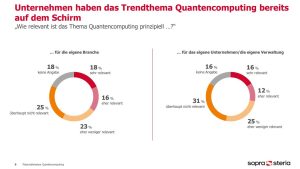Auch interne Prozesse betroffen
Unternehmen und Behörden scheuen Datenaustausch
Vier von zehn Unternehmen und Behörden tauschen intern keine Daten aus. Über Unternehmensgrenzen hinweg sind zwölf Prozent der befragten Entscheiderinnen und Entscheider dazu bereit, Daten mit anderen Unternehmen oder Behörden zu teilen, um damit Prozesse zu verbessern oder Innovationen voranzutreiben.
Um mit dem technologischen Fortschritt mithalten zu können, arbeiten Organisationen zunehmend mit Startups oder gar Konkurrenten zusammen. Diese Zusammenschlüsse funktionieren allerdings nur, wenn die Partner untereinander Markt- und anonymisierte Kundendaten oder Software-Code teilen. Dazu sind in der Fläche laut einer Studie der Managementberatung Sopra Steria wenige Unternehmen bereit. Zwölf Prozent der befragten Entscheiderinnen und Entscheider würden interne Daten mit anderen Unternehmen oder Behörden teilen, um damit Prozesse zu verbessern oder Innovationen voranzutreiben. Mit der Bereitstellung von Kompetenzen haben dagegen die wenigsten Organisationen Probleme. Auch Wissen und Ideen werden von 41 Prozent extern und 78 Prozent intern geteilt.
Fehlende ‘Datenkultur’
“Die Zahlen zeigen, wie zurückhaltend Organisationen in Deutschland sind und dass Open Innovation und Zusammenarbeit an eine Grenze stoßen, wenn es um das Teilen von Daten geht”, sagt Torsten Raithel, Experte für Data & Analytics bei Sopra Steria. “Daten sind für Unternehmen immer noch ein gut gehütetes Geheimnis, und in der öffentlichen Verwaltung erschweren häufig föderale Unterschiede das Teilen von Daten über Bundesländergrenzen hinweg. Sowohl die Wirtschaft als auch der öffentliche Sektor sind gefordert, die passenden Voraussetzungen zu schaffen”, so Raithel.
Nachholbedarf sieht der Berater beim Aufbau einer Datenkultur: “Daten zu teilen heißt, sich ein Stückweit zu offenbaren und die puren Zahlen ohne Filter und ohne Möglichkeit zur Beschönigung offenzulegen. Offenheit erfordert zudem ein Bewusstsein, dass Daten zu teilen keinen Knowhow-Verlust bedeutet”, sagt Torsten Raithel. Dieses Verständnis ist bei Unternehmen und Behörden in Deutschland nur schwach ausgeprägt. 48 Prozent der Befragten führen in der Studie fehlendes Vertrauen und Angst vor Missbrauch der geteilten Daten als Hauptgründe gegen enge Partnerschaften an. 43 Prozent befürchten in Kooperationen einen Datenverlust.
Interner Handlungsbedarf
Handlungsbedarf besteht auch in den Unternehmen und Behörden selbst. Es werden zwar intern mehr Daten geteilt, allerdings längst nicht in der Breite. Vor allem öffentliche Verwaltungen (44 Prozent) und Finanzdienstleister (43 Prozent) stellen ihre Daten nicht teamübergreifend zur Verfügung. 37 Prozent der Befragten bemängeln selbst eine fehlende Kultur der Offenheit in ihren Unternehmen oder Verwaltungen. Jede zweite Organisation will ein offenes Mindset fördern. 42 Prozent arbeiten beispielsweise an der Transparenz. Technische Voraussetzungen wie die Einführung von Data Warehouse, Data Mesh oder neuen Schnittstellen zwischen den Teams können laut Sopra-Steria-Berater Torsten Raithel immer erst der zweite Schritt nach dem Veränderungsprozess in den Köpfen sein.
Zweifel an der Datenqualität
Neben der grundsätzlichen Skepsis, Daten zu teilen, zweifeln viele der befragten Entscheiderinnen und Entscheider, auch an der Güte der externen Informationen – beispielsweise aus Open-Data-Quellen. Nur drei Prozent würden bedenkenlos mit externen Open-Data-Angeboten von Unternehmen arbeiten. Rund zwei Drittel der Organisationen erlauben sich kein oder nur ein fallabhängiges Urteil über die Datenqualität anderer Unternehmen. Selbst den offenen Daten von Behörden trauen nur sieben Prozent bedenkenlos. Die Skepsis basiert häufig auf fehlenden Bewertungskriterien: Jede dritte Organisation traut sich keine Beurteilung externer Daten zu, bei Verwaltungen ist es jede vierte.
„Misstrauen resultiert oft aus Unkenntnis darüber, welche Daten überhaupt zur Verfügung stehen. Außerdem stellt sich die Frage, ob die richtigen Zahlen und Fakten offengelegt werden. Diejenigen, die offene Daten nicht nutzen, sehen darin wahrscheinlich keinen Nutzen für ihre Organisation“, erklärt Torsten Raithel. „Gerade bei Angeboten von Behörden ist die Datenqualität gut und durchläuft viele Freigabeprozesse. Ich sehe kein Problem bei der Datenquelle, sondern vielmehr bei der Integration und dem Management von Metadaten, um beispielsweise Informationen schnell zu finden und ihren Nutzen für die eigene Arbeit zu bewerten.“
Bei der Herausgabe und Verarbeitung von Daten nennen die Befragten in ihren Organisationen weitere Herausforderungen: Für 48 Prozent sind rechtliche und regulatorische Hürden das größte Hindernis für enge Partnerschaften. 43 Prozent sagen, Datenschutz bremst Open Data unnötig. „In Deutschland wird dem Datenschutz grundsätzlich ein sehr hoher Stellenwert eingeräumt und er wird schärfer interpretiert als sonst im europäischen Raum. Aus Angst vor Fehlern verzichten Mitarbeitende dann auf den Datenaustausch“, sagt Raithel. „Auch das ist eine Kulturfrage. Unternehmen und Behörden müssen ihren Mitarbeitenden stärker vermitteln, wie sie den Freiraum zum Nutzen und Teilen von Daten innerhalb regulatorischer Grenzen ausschöpfen.“
Das könnte Sie auch interessieren

Werkzeugbahnen für Zerspanprozesse in CAM-Systemen zu planen erfordert Expertenwissen. Viele Parameter müssen bestimmt und geprüft werden, um die Bahnplanung Schritt für Schritt zu optimieren. Im Projekt CAMStylus arbeiten die Beteiligten daran, diese Aufgabe zu vereinfachen - per KI-gestützter Virtual-Reality-Umgebung.‣ weiterlesen

In einer Studie von Techconsult in Zusammenarbeit mit Grandcentrix wurden 200 Unternehmen ab 250 Beschäftigten aller Branchen zum Thema ESG in ihren Unternehmen befragt. Die Studie hebt die zentrale Rolle der jüngsten CSR-Direktive der EU bei der Förderung von Transparenz und Nachhaltigkeit in Unternehmen hervor. Dabei beleuchtet sie die Fortschritte und Herausforderungen bei der Umsetzung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) im Zusammenhang mit der Nutzung von IoT-Technologien.‣ weiterlesen

Der weltweite Wettbewerb mit chinesischen Unternehmen wird härter, da die Produkte aus Fernost besser werden und fast immer günstiger sind. Aber Chinas Industrie profitiert auch von Subventionen auf breiter Front. Eine vom VDMA beauftragte Studie bilanziert die Wettbewerbsposition Chinas auf den Weltmärkten im Maschinen- und Anlagenbau und zeigt Handlungsoptionen auf.‣ weiterlesen

AappliedAI hat vier KI Use Cases identifiziert, die es dem produzierenden Gewerbe ermöglichen, ihre Effizienz und Produktivität zu steigern. Mit der Anwendung bewährter Technologien können sich die Investitionen bereits nach einem Jahr amortisieren.‣ weiterlesen

Hinter jedem erfolgreichen Start-up steht eine gute Idee. Bei RockFarm sind es gleich mehrere: Das Berliner Unternehmen baut nachhaltige Natursteinmauern aus CO2 bindendem Lavagestein. Oder besser gesagt, es lässt sie bauen - von einem Yaskawa-Cobot HC10DTP.‣ weiterlesen

Mit über 2,2Mio.t verarbeitetem Schrott pro Jahr ist die Swiss Steel Group einer der größten Recyclingbetriebe Europas. Für seinen 'Green Steel', also Stahl aus recyceltem Material, arbeitet das Unternehmen an einem digitalen Zwilling des ankommenden Schrotts.‣ weiterlesen

Laut einer aktuellen Studie von Hitachi Vantara betrachten fast alle der dafür befragten Unternehmen GenAI als eine der Top-5-Prioritäten. Aber nur 44 Prozent haben umfassende Governance-Richtlinien eingeführt.‣ weiterlesen
61 Prozent der Unternehmen in Deutschland wollen laut einer Bitkom-Befragung per Cloud interne Prozesse digitalisieren, vor einem Jahr waren es nur 45 Prozent. Mittelfristig wollen die Unternehmen mehr als 50 Prozent ihrer Anwendungen in die Cloud verlagern.‣ weiterlesen

Wie wirkt sich die Digitalisierung auf die Gesundheit verschiedener Beschäftigungsgruppen aus? Dieser Frage ist das ZEW Mannheim nachgegangen und kommt zu dem Ergebnis, dass sich vor allem der Gesundheitszustand von Arbeitern verschlechtert.‣ weiterlesen

Mit generativer KI erlebt 'Right Brain AI', also eine KI, die kreative Fähigkeiten der rechten menschlichen Gehirnhälfte nachahmt, derzeit einen rasanten Aufstieg. Dieser öffnet aber auch die Tür für einen breiteren Einsatz von eher analytischer 'Left Brain AI'. Das zeigt eine aktuelle Studie von Pegasystems.‣ weiterlesen
Um klima- und ressourcengerechtes Bauen voranzubringen, arbeiten Forschende der Bergischen Universität Wuppertal in ihrem Projekt TimberConnect an der Optimierung von digitalen Prozessen entlang der Lieferkette von Holzbauteilen. Ihr Ziel ist unter anderem, digitale Produktpässe zu erzeugen.‣ weiterlesen