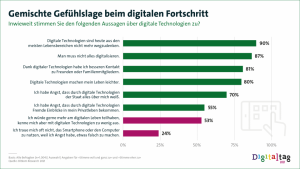MVO statt MRL
Was bedeutet die EU-Maschinenverordnung für Unternehmen?
Betriebs- und Produktionsleiter müssen sich seit Juli 2023 mit neuen Vorgaben zur Maschinensicherheit befassen. Die EU-Maschinenverordnung 2023/1230 (MVO) ersetzt die bisherige Maschinenrichtlinie (MRL). Sie erweitert den Kreis der Betroffenen, liefert einheitliche Begriffe und passt die Anforderungen an den Stand der Technik an. Zudem erfasst das Gesetz nun auch die Digitalisierung.
Die Maschinenverordnung ist mit rund 300 Seiten deutlich umfangreicher als die mittlerweile 14 Jahre alte Richtlinie. Eine Revolution ist sie nicht. Die Anforderungen an die Maschinensicherheit bleiben im Kern die gleichen. Gleichwohl enthält die Verordnung zahlreiche Konkretisierungen und neue Definitionen. Das fängt bereits an mit der Liste der als Wirtschaftsakteure bezeichneten Betroffenen: Ausdrücklich genannt sind Händler, Importeure und Bevollmächtigte. Betreiber sind jedoch indirekt eingeschlossen, weil sie rechtlich zu Händlern werden, wenn sie Gebrauchtmaschinen weiterverkaufen. Dieser Logik folgend umfasst die neue Verordnung die gesamte Lieferkette.
Der Begriff Wirtschaftsakteure zeigt, dass die MVO dem Konzept des New Legislative Framework (NLF) folgt. Damit vereinheitlicht die EU Standards, z.B. die Vorgaben für Konformitätsbewertungen, die Akkreditierung von Prüforganisationen oder die Marktüberwachung.
Von der digitalen Betriebsanleitung bis zur KI
Die fortschreitende Automatisierung und Vernetzung haben neue Sicherheitsrisiken geschaffen. Diese wurden bislang durch die MRL nicht ausdrücklich erfasst. Deshalb ist das Thema Digitalisierung die entscheidende inhaltliche Neuerung der MVO. Sie erlaubt künftig, Dokumente wie Betriebsanleitungen oder Konformitätserklärungen online bereitzustellen. Vorausgesetzt wird ein Hinweis auf dem Produkt selbst oder in den ausgedruckten Begleitunterlagen, wo die digitalen Unterlagen zu finden sind. Die Dokumente müssen von jedem Endgerät zugänglich und druckbar sein, sowie mindestens 10 Jahre vorgehalten werden. Zudem muss den zuständigen Behörden auf Nachfrage eine ausgedruckte Version der Unterlagen ausgehändigt werden.
Der Einsatz künstlicher Intelligenz muss fortan in der Risikobewertung berücksichtigt werden. So werden Risiken adressiert, die überhaupt erst durch KI-Systeme entstehen. Betroffen davon sind sogenannte autonome bzw. hochautomatisierte Maschinen. KI-Systeme, die Sicherheitsfunktionen steuern, sowie Maschinen, in die solche Systeme integriert sind, sind mit höheren Betriebsrisiken verbunden. Für diese in Anhang I Teil A und Teil B der MVO gelistete Produktklasse gelten besondere Anforderungen an das Konformitätsbewertungsverfahren: Insbesondere für Produkte, die im Teil A zu finden sind, ist eine benannte Stelle hinzuzuziehen, eine interne Fertigungskontrolle genügt nicht. Hersteller autonomer Maschinen müssen in die Risikobewertung auch jene Risiken einfließen lassen, die sich erst nach dem Inverkehrbringen aus dem autonomen, also KI-gestützten Einsatz ergeben.
Berücksichtigt Cybersicherheit
Neben KI-gestützten Maschinen(-teilen) wie Industrierobotern gehören auch Fahrzeughebebühnen zu dieser Gruppe. Die Liste ist nicht abschließend. Die Europäische Kommission kann den Anhang I mittels Rechtsakten immer wieder dem Stand der Technik anpassen. Ein höheres Betriebsrisiko geht in der Regel mit einer aufwändigeren Konformitätsbewertung einher. Unter Umständen muss auch eine benannte Stelle hinzugezogen werden. Diese Fälle sind in Anhang I Teil A beschrieben, oder auch im Teil B, sofern keine harmonisierte Produktnorm existiert.
Ein weiterer wesentlicher Aspekt der Digitalisierung ist die Cybersecurity. Die MVO geht insofern darauf ein, als dass sie ausdrücklich die Korrumpierungssicherheit gegen Online-Zugriffe fordert. Hersteller müssen also Maßnahmen ergreifen, die verhindern, dass die Verbindung mit externen Datenträgern oder internetbasierten Fernsteuerungen zu gefährlichen Situationen führt. Die Regelungen sind Teil der Cyberstrategie der EU.
Das könnte Sie auch interessieren

Werkzeugbahnen für Zerspanprozesse in CAM-Systemen zu planen erfordert Expertenwissen. Viele Parameter müssen bestimmt und geprüft werden, um die Bahnplanung Schritt für Schritt zu optimieren. Im Projekt CAMStylus arbeiten die Beteiligten daran, diese Aufgabe zu vereinfachen - per KI-gestützter Virtual-Reality-Umgebung.‣ weiterlesen

In einer Studie von Techconsult in Zusammenarbeit mit Grandcentrix wurden 200 Unternehmen ab 250 Beschäftigten aller Branchen zum Thema ESG in ihren Unternehmen befragt. Die Studie hebt die zentrale Rolle der jüngsten CSR-Direktive der EU bei der Förderung von Transparenz und Nachhaltigkeit in Unternehmen hervor. Dabei beleuchtet sie die Fortschritte und Herausforderungen bei der Umsetzung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) im Zusammenhang mit der Nutzung von IoT-Technologien.‣ weiterlesen

AappliedAI hat vier KI Use Cases identifiziert, die es dem produzierenden Gewerbe ermöglichen, ihre Effizienz und Produktivität zu steigern. Mit der Anwendung bewährter Technologien können sich die Investitionen bereits nach einem Jahr amortisieren.‣ weiterlesen

Hinter jedem erfolgreichen Start-up steht eine gute Idee. Bei RockFarm sind es gleich mehrere: Das Berliner Unternehmen baut nachhaltige Natursteinmauern aus CO2 bindendem Lavagestein. Oder besser gesagt, es lässt sie bauen - von einem Yaskawa-Cobot HC10DTP.‣ weiterlesen

Mit über 2,2Mio.t verarbeitetem Schrott pro Jahr ist die Swiss Steel Group einer der größten Recyclingbetriebe Europas. Für seinen 'Green Steel', also Stahl aus recyceltem Material, arbeitet das Unternehmen an einem digitalen Zwilling des ankommenden Schrotts.‣ weiterlesen

Laut einer aktuellen Studie von Hitachi Vantara betrachten fast alle der dafür befragten Unternehmen GenAI als eine der Top-5-Prioritäten. Aber nur 44 Prozent haben umfassende Governance-Richtlinien eingeführt.‣ weiterlesen
61 Prozent der Unternehmen in Deutschland wollen laut einer Bitkom-Befragung per Cloud interne Prozesse digitalisieren, vor einem Jahr waren es nur 45 Prozent. Mittelfristig wollen die Unternehmen mehr als 50 Prozent ihrer Anwendungen in die Cloud verlagern.‣ weiterlesen

Mit generativer KI erlebt 'Right Brain AI', also eine KI, die kreative Fähigkeiten der rechten menschlichen Gehirnhälfte nachahmt, derzeit einen rasanten Aufstieg. Dieser öffnet aber auch die Tür für einen breiteren Einsatz von eher analytischer 'Left Brain AI'. Das zeigt eine aktuelle Studie von Pegasystems.‣ weiterlesen
Um klima- und ressourcengerechtes Bauen voranzubringen, arbeiten Forschende der Bergischen Universität Wuppertal in ihrem Projekt TimberConnect an der Optimierung von digitalen Prozessen entlang der Lieferkette von Holzbauteilen. Ihr Ziel ist unter anderem, digitale Produktpässe zu erzeugen.‣ weiterlesen

Rund zwei Drittel der Erwerbstätigen in Deutschland verwenden ChatGPT und Co. zumindest testweise, 37 Prozent arbeiten regelmäßig mit KI-Anwendungen. Doch auch Cyberkriminelle machen sich vermehrt die Stärken künstlicher Intelligenz zunutze - mit weitreichenden Folgen.‣ weiterlesen

Erstmals seit der Energiekrise verzeichnet der Energieeffizienz-Index der deutschen Industrie mit allen drei Teilindizes (die Bedeutung, Produktivität und Investitionen betreffend) einen leichten Rückgang. Mögliche Gründe erkennt EEP-Institutsleiter Professor Alexander Sauer in der Unsicherheit und der drohenden Rezession, der dadurch getriebenen Prioritätenverschiebung und der Reduktion von Produktionskapazität.‣ weiterlesen