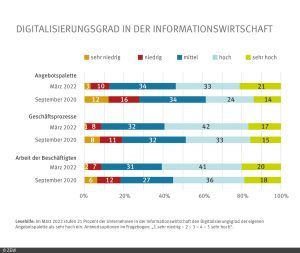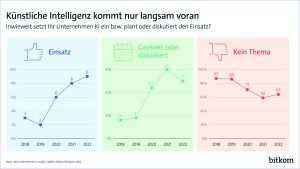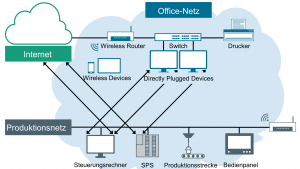Digitale Technologien können helfen, werden aber unterschiedlich bewertet
Nachhaltigkeitsinvestitionen fokussieren auf Klimaschutz
Wirtschaft und öffentliche Verwaltung in Deutschland investieren beim Thema Nachhaltigkeit aktuell vor allem in den Faktor Umwelt. Eine ganzheitlich nachhaltige Wertschöpfung ist laut einer Untersuchung von Sopra Steria und Des F.A.Z. Instituts aber noch noch Zukunftsmusik.

(Bild: ©Deemerwha-studio/stock.adobe.com)
Ganzheitlich nachhaltig wirtschaftende Unternehmen und Verwaltungen setzen etwa erneuerbare Energien ein, sorgen für gerechte Arbeitsbedingungen und bekämpfen aktiv Korruption in ihrer Wertschöpfungskette. Sie sind somit auf allen drei Feldern des so genannten ESG-Modells (Environment = Umwelt, Social = Soziales und Governance = nachhaltige Unternehmensführung) aktiv. Generell sind für die Mehrheit der 322 befragten Führungskräfte alle drei Ebenen wichtig, so die Studie – vor allem in den Konzernen. In der Praxis beschränken sich Aktivitäten oft auf den Faktor Umwelt. Rund die Hälfte der befragten Unternehmen und Behörden steigert die Nutzung erneuerbarer Energien, reduziert Schadstoffemissionen und arbeitet an einem effizienteren Verbrauch von Material und Energie. Soziale Nachhaltigkeit sowie eine auf Werte ausgerichtete Unternehmenslenkung werden laut Studie seltener konkret angegangen. 38 Prozent der befragten Arbeitgeber setzen nach eigenen Angaben derzeit beispielsweise Maßnahmen zur Senkung der Unfall- und Krankheitsrate um, in etwa genau so vielen Organisationen laufen Programme, um mehr Frauen in die Chefetagen zu bringen.
“Es ist nachvollziehbar, dass sich Nachhaltigkeitsaktivitäten derzeit auf die Ökologie und dabei meist auf den eigenen CO2-Fußabdruck fokussieren. Für das Erreichen der Klimaziele gibt es klare Vorgaben, sich zu bewegen, und einen Zeitplan”, sagt Frédéric Munch, Vorstand von Sopra Steria. “Ein Engagement, das nur auf Klimaschutz abzielt, greift allerdings zu kurz. Soziale, ethische und ökologische Anforderungen sollten denselben Stellenwert genießen und gleichermaßen angegangen werden”, so Munch.
Motivation durch Gesetze
Die Motivation, sich nachhaltiger aufzustellen, schöpft die Mehrheit der Befragten von außen – oftmals nur als Folge von Gesetzen, so das Ergebnis der Studie. Nur ein Viertel hält es für zielführend, wenn Unternehmen absolut freiwillig für eine nachhaltige Wertschöpfung sorgen. Für zwei Drittel ist die Bedeutung des Themas in der Gesellschaft so groß, dass man nicht mehr daran vorbeikommt. In jedem zweiten Unternehmen hat laut Studie zudem ein kultureller Umbruch eingesetzt. Als Folge werden Investitionen zum Erreichen von Netto-Null-Emissionen priorisiert und Projekte mit mehr Budget ausgestattet als noch vor zwei Jahren. Das Risiko abwandernder Kunden oder von Kündigungen der Beschäftigten aufgrund mangelnder Nachhaltigkeitsmaßnahmen spielt insgesamt eine geringere Rolle.
Gewinnsteigerung nicht im Fokus
Auffällig sei, so die Studienautoren, dass nur wenige Unternehmen in Nachhaltigkeit investieren, um damit Umsatz und Gewinn zu steigern oder Kosten zu senken. Laut Studie macht sich nachhaltiges Wirtschaften noch am ehesten in der verarbeitenden Industrie in den Bilanzen bemerkbar. Jedes vierte Unternehmen sieht langfristig Kostenvorteile, beispielsweise bei der Beseitigung von Folgeschäden. Großunternehmen spüren im Vergleich zum Mittelstand und zu Kleinunternehmen einen deutlich größeren Druck von Seiten der Aktionäre. Eine saubere ESG-Weste werde immer stärker zum Anlagekriterium, so die Studienautoren.
“In den Führungsetagen muss sich noch stärker das Bewusstsein verankern, dass sich Equal Pay, Diversität, langfristige Unternehmenssteuerung und Ressourcenschonung positiv in den Büchern auswirken und Nachhaltigkeit auch ein recht unbestelltes Feld für innovative Geschäftsmodelle ist”, so Munch. Zudem brauche es konkrete Nachhaltigkeits-KPIs, die Auswirkungen auf Gewinn und Verlust darstellen. Ein Instrument dafür sind digitale Technologien. Digitalisierung gilt auf der einen Seite als Nachhaltigkeitsproblem – etwa in Sachen Energieverbrauch -, auf der anderen Seite gilt sie als wichtiger Verbündeter, der Maßnahmen erleichtert, Auswirkungen von Maßnahmen analysiert, Transparenz schafft und die Einhaltung von Standards überwacht.
Die logische Konsequenz, dass die Veränderung in Richtung einer nachhaltigen Wirtschaft und nachhaltigen Verwaltung nur mithilfe digitaler Technologien gelingt, wird derzeit unterschiedlich gesehen, so die Studie. 54 Prozent der Befragten teilen die These und sehen in der Digitalisierung einen wichtigen Helfer. Das gilt in erster Linie für Banken und Versicherer (63 Prozent), in der öffentlichen Verwaltung sind die Befragten skeptischer (42 Prozent).
mst/Sopra Steria
Das könnte Sie auch interessieren

Werkzeugbahnen für Zerspanprozesse in CAM-Systemen zu planen erfordert Expertenwissen. Viele Parameter müssen bestimmt und geprüft werden, um die Bahnplanung Schritt für Schritt zu optimieren. Im Projekt CAMStylus arbeiten die Beteiligten daran, diese Aufgabe zu vereinfachen - per KI-gestützter Virtual-Reality-Umgebung.‣ weiterlesen

Wanja Wiese untersucht die Bedingungen, die für ein Bewusstsein erfüllt sein müssen. Mindestens eine findet er im Computer nicht.‣ weiterlesen

In einer Studie von Techconsult in Zusammenarbeit mit Grandcentrix wurden 200 Unternehmen ab 250 Beschäftigten aller Branchen zum Thema ESG in ihren Unternehmen befragt. Die Studie hebt die zentrale Rolle der jüngsten CSR-Direktive der EU bei der Förderung von Transparenz und Nachhaltigkeit in Unternehmen hervor. Dabei beleuchtet sie die Fortschritte und Herausforderungen bei der Umsetzung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) im Zusammenhang mit der Nutzung von IoT-Technologien.‣ weiterlesen

AappliedAI hat vier KI Use Cases identifiziert, die es dem produzierenden Gewerbe ermöglichen, ihre Effizienz und Produktivität zu steigern. Mit der Anwendung bewährter Technologien können sich die Investitionen bereits nach einem Jahr amortisieren.‣ weiterlesen

Hinter jedem erfolgreichen Start-up steht eine gute Idee. Bei RockFarm sind es gleich mehrere: Das Berliner Unternehmen baut nachhaltige Natursteinmauern aus CO2 bindendem Lavagestein. Oder besser gesagt, es lässt sie bauen - von einem Yaskawa-Cobot HC10DTP.‣ weiterlesen

Mit über 2,2Mio.t verarbeitetem Schrott pro Jahr ist die Swiss Steel Group einer der größten Recyclingbetriebe Europas. Für seinen 'Green Steel', also Stahl aus recyceltem Material, arbeitet das Unternehmen an einem digitalen Zwilling des ankommenden Schrotts.‣ weiterlesen

Laut einer aktuellen Studie von Hitachi Vantara betrachten fast alle der dafür befragten Unternehmen GenAI als eine der Top-5-Prioritäten. Aber nur 44 Prozent haben umfassende Governance-Richtlinien eingeführt.‣ weiterlesen
61 Prozent der Unternehmen in Deutschland wollen laut einer Bitkom-Befragung per Cloud interne Prozesse digitalisieren, vor einem Jahr waren es nur 45 Prozent. Mittelfristig wollen die Unternehmen mehr als 50 Prozent ihrer Anwendungen in die Cloud verlagern.‣ weiterlesen

Mit generativer KI erlebt 'Right Brain AI', also eine KI, die kreative Fähigkeiten der rechten menschlichen Gehirnhälfte nachahmt, derzeit einen rasanten Aufstieg. Dieser öffnet aber auch die Tür für einen breiteren Einsatz von eher analytischer 'Left Brain AI'. Das zeigt eine aktuelle Studie von Pegasystems.‣ weiterlesen
Um klima- und ressourcengerechtes Bauen voranzubringen, arbeiten Forschende der Bergischen Universität Wuppertal in ihrem Projekt TimberConnect an der Optimierung von digitalen Prozessen entlang der Lieferkette von Holzbauteilen. Ihr Ziel ist unter anderem, digitale Produktpässe zu erzeugen.‣ weiterlesen

Rund zwei Drittel der Erwerbstätigen in Deutschland verwenden ChatGPT und Co. zumindest testweise, 37 Prozent arbeiten regelmäßig mit KI-Anwendungen. Doch auch Cyberkriminelle machen sich vermehrt die Stärken künstlicher Intelligenz zunutze - mit weitreichenden Folgen.‣ weiterlesen