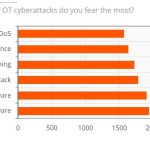Wie Unternehmen MINT-Nachwuchs gewinnen

Simone Schiebold, geschäftsführende Gesellschafterin bei Flad & Flad (Bild: Flad & Flad Communication GmbH)
Vorbilder für die Kommunikation auf Augenhöhe
All diese Live-Erlebnisse brauchen eine Begleitung. Azubis oder Berufsanfänger eignen sich hervorragend als Guide für Jugendliche. Sie kommunizieren auf Augenhöhe, sprechen die Sprache junger Menschen und berichten authentisch über ihren Arbeitsalltag. Das gilt nicht nur für Führungen durchs Unternehmen, für Workshops in Schulen oder Präsenzen auf Messen, sondern auch für das rein digitale Personalmarketing rund um MINT-Praktika, -Ausbildungsplätze und -Karrieren.
Die jungen MINT-Botschafter sollten Schülerinnen und Schülern über Videos, Podcasts oder Online-Workshops auf Karriereseiten und über Social-Media-Kanäle adressieren. Das erweitert die Live-Experience in den digitalen Raum und schafft zusätzliche Reichweite. Bei jeder Content-Erstellung ist kreatives Storytelling zu berücksichtigen. Dabei kann die Story nach dem Live-Erlebnis weitergehen oder – je nach Dramaturgie – auch vor dem Event beginnen. Eine Hybride Experience verzahnt dabei intelligent Live- und digitale Instrumente zu einem ganzheitlichen und langfristigen MINT-Erlebnis.
Um den Zugang zu Lehrkräften zu bekommen und sich mit dem eigenen Knowhow für die berufliche Orientierung an Schulen einzubringen, sollten sich Industrieunternehmen, die eigene MINT-Initiativen umsetzen wollen, an den Lehrplänen orientieren. Sie können etwa prüfen, an welchen Stellen oder Prozessen und von welchen Berufen die im Unterricht vermittelten Lerninhalte angewendet werden. Denn Wissen, das spannend, praxisbezogen und holistisch vermittelt wird, hat eine große Chance, junge Menschen für MINT-Berufe nachhaltig zu begeistern. Die komplexen Berufsbilder werden am besten durch eine Mischung aus Live-Erlebnissen und digitalen Angeboten anschaulich gemacht. Sie sind dann besonders erfolgreich, wenn sie am persönlichen Alltag der Jugendlichen anknüpfen und diese zur Partizipation motivieren.
Das könnte Sie auch interessieren
Zwar ist die Fachkräftelücke im MINT-Bereich im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Dennoch konnten laut einer Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft mindestens 235.400 Stellen nicht besetzt werden.‣ weiterlesen

Nach Bitkom-Berechnungen fehlen bis zum Jahr 2040 mehr als 660.000 IT-Fachkräfte. Welche Maßnahmen helfen könnten, diesem Trend entgegenzuwirken, hat der Verband beleuchtet. Potenziale liegen unter anderem darin, mehr Frauen für IT-Berufe zu begeistern oder den Quereinstieg zu erleichtern.‣ weiterlesen

Jeder zweite Betrieb investiert laut einer Betriebsräte-Befragung der IG Metall zu wenig am Standort. Demnach verfügen rund 48 Prozent der Unternehmen über eine Transformationsstrategie. Zudem sehen die Betriebsräte ein erhöhtes Risiko für Verlagerungen.‣ weiterlesen

Die Zahl der offenen Stellen in den Ingenieurberufen ist trotz konjunktureller Eintrübung hoch. Laut VDI Ingenieurmonitor beginnen allerdings weniger Menschen ein Studium in Ingenieurwissenschaften und Informatik.‣ weiterlesen

Für die Digitalisierung braucht es in Zukunft mehr Fachkräfte. Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt, in welchen Digitalisierungsberufen bis 2027 die meisten Stellen unbesetzt bleiben dürften.‣ weiterlesen

Marktunsicherheiten halten Unternehmen laut einer Untersuchung der Unternehmensberatung Horváth nicht von Transaktionen ab. Sechs von zehn Industrieunternehmen sind gezielt auf der Suche nach Kaufoptionen mit KI-Expertise.‣ weiterlesen

Deutsche Unternehmen sehen den Einsatz von Digitalisierung und KI zur Optimierung der Effizienz und zur Senkung des Energieverbrauchs als effektiver an als Offshoring. Das geht aus einer Untersuchung von Statista im Auftrag von Avanade hervor.‣ weiterlesen

Laut einer Untersuchung der Job-Plattform Stepstone halten Unternehmen vermehrt nach Beschäftigten mit KI-Skills Ausschau. Soft Skills sind im untersuchten Zeitraum sogar noch gefragter gewesen. Für die Untersuchung hat Stepstone alle Stellenangebote seit 2019 analysiert.‣ weiterlesen

Die Ausgaben der Wirtschaft für Innovationen sind im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr in Deutschland deutlich um 6,8 Prozent auf 190,7Mrd.€ angestiegen. Dies geht aus der aktuellen Innovationserhebung 2023 des ZEW Mannheim im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) hervor.‣ weiterlesen

Für das aktuelle Allianz Risk Barometer wurden 3000 Risikoexperten befragt. Das Ergebnis: Als größte Risiken nennen die Teilnehmer Datenpannen, Angriffe auf kritische Infrastruktur oder Vermögenswerte und vermehrte Ransomware-Attacken. Anders als weltweit schafft es der Fachkräftemangel in Deutschland auf Platz 4.‣ weiterlesen

In Potsdam laufen die Vorbereitungen für eine vollständig digitale Universität. Die beiden Initiatoren Mike Friedrichsen und Christoph Meinel wollen damit dem IT-Fachkräftemangel entgegenwirken.‣ weiterlesen